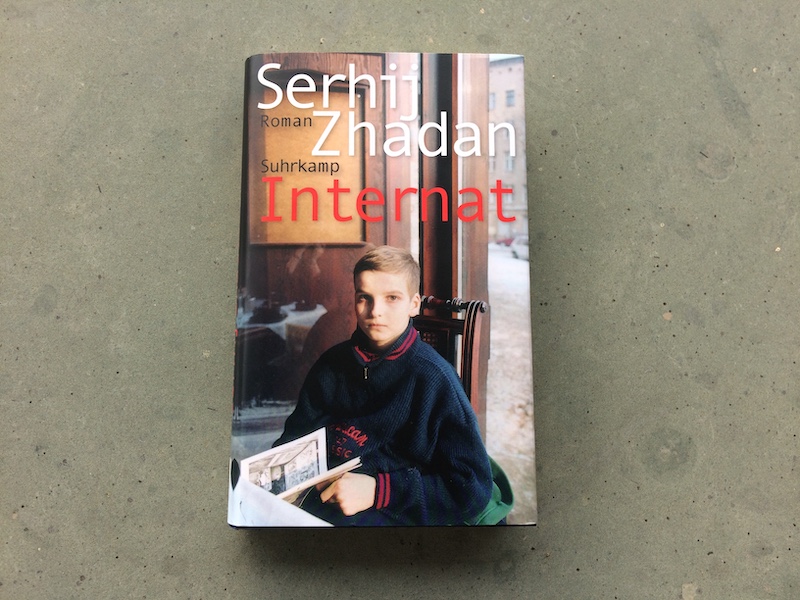Wenn in diesen Tagen über die Literatur der Ukraine gesprochen wird, fällt unweigerlich der Name Serhij Zhadan. Der Autor und Musiker, der in Charkiw lebt, ist einer der populärsten Künstler der Ukraine und sein Roman „Internat“ der derzeit wohl bekannteste des Landes. Juri Durkot und Sabine Stöhr, die gemeinsam das Werk Zhadans ins Deutsche übertragen, sind für ihre Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet worden und erhielten 2018 für die Übersetzung von „Internat“ den Preis der Leipziger Buchmesse.
Pascha, ein Lehrer Mitte Dreißig lebt mit seinem Vater nahe einer namenlosen Stadt, die irgendwo im Donbass angesiedelt sein muss. Als ein Krieg diese Stadt einholt – Zhadan benennt an keiner Stelle den Aggressor, der Name Russlands fällt nicht – macht sich Pascha auf den Weg, um seinen Neffen Sascha aus dem Internat zu holen, wo der Junge von seiner Mutter untergebracht worden ist, weil diese mit ihm nicht mehr fertig wird.
Pascha ist einer, der sich raushalten will. Er lebt noch immer im Elternhaus, seine Freundin hat ihn verlassen, weil er nicht das Land verlassen wollte. Außerdem schaut Pascha kein Fernsehen mehr, „seit die Nachrichten nur noch Angst machen“. Er unterrichtet Ukrainisch. Mit seinen Schülern spricht Pascha nicht über Politik. „Ich unterrichte Sprachen“, versucht er sich zurückzuziehen, dabei ist die Sprache, die er lehrt, schon längst zum Politikum geworden. Nur Pascha will es noch nicht wahrhaben. Am Ende des Romans wird ein Journalist vieldeutig sagen: „Das ist ja wie Latein unterrichten.“
An einem Januarmorgen beginnt Paschas drei Tage währende Odyssee durch den vom Krieg zerstörten Landstrich. Als er den Jungen schließlich im Internat findet, versuchen beide die Heimreise anzutreten. Doch als sie an einer feindlichen Militärkolonne nicht vorbeikommen, müssen sie umkehren. Zurück im Internat, stellen sie fest, dass alle Menschen, die wenige Stunden zuvor noch da waren, verschwunden sind. Von jetzt auf gleich ist von ihnen nichts zurückgeblieben als ein zerschossener Mantel. Als Pascha der Verzweiflung nahe ist, weil er nicht mehr weiß, auf welchem Weg sie nach Hause kommen sollen, weiß der Junge Rat und schlägt einfach den Weg ein, auf dem Pascha gekommen ist. Und so zieht erneut die Kriegsszenerie an ihnen vorbei, sie begegnen Menschen, die Pascha auf dem Hinweg getroffen hat, oder finden nur noch Dinge, die von ihnen übrig geblieben sind.
Paschas Weg ist ein apokalyptischer Reigen. Zhadan führt seinen Helden durch das vom Krieg verwüstete Land, über das ein nicht enden wollender Nebel hinwegzieht. Werte und Orientierung sind abhanden gekommen. In einer Szene schaut Pascha in den sternenlosen Himmel, an dem ein Alter den Polarstern vermutet, aber der Himmel ist leer: „Da ist nichts. Kein Mitleid mit niemandem.“
In ausdrucksstarken Bildern und konziser Sprache führt Zhadan vor Augen, was Krieg mit Menschen und aus Menschen macht, von denen nichts bleibt, als eine Pelzjacke im Matsch oder ein ins Leere klingelndes Handy. Gleich am Anfang von Paschas Reise gibt es eine Szene, die für mich zu den verstörendsten Bildern des Romans gehört. Männer verlassen die eroberte Stadt nach dem verlorenen Kampf, werden zu einer Menge, die auf die Wartenden, die das Ganze beobachten, zuströmt. Das Unheil, das der Sieg der Besatzer über die Stadt bringt, ist zu erahnen. Aus dem abstrakten Menschenstrom, der zunächst nur aus der Entfernung wahrzunehmen ist, treten in kurzer Distanz Einzelne hervor. Der Krieg wird für Pascha und den Leser jetzt greifbar und man kann sich ihm nicht mehr entziehen:
„Pascha sieht nur, wie man die Bahre vorsichtig hineinreicht, bemerkt das verklebte Haar und die zuckrige Weiße des Knochens, als habe man eine Honigmelone aufgeschnitten und ihre süßen Innereien nach außen gekehrt, bemerkt die verkrampfte Hand, die sich an die Bahre klammert, so fest, wie man sich sonst nur an das Leben klammert.“
Zhadan erzählt diesen Weg durch die vom Krieg zerstörte Welt als apokalyptische Heldenreise, auf der Pascha ungewollt einer wird, der in Verantwortung stolpert, sie widerwillig übernimmt, schließlich sein Wort erhebt, um zu erkennen, dass er seinen Platz in der Welt niemals verlassen wird, weil er sich dauerhaft keinen anderen Platz in der Welt nimmt und weil ihm die – vorrangig westliche – Welt keinen anderen Platz einräumt. „Warum bist Du so zu ihm?“ fragt der Junge am Ende, als Pascha einen westlichen Journalisten abfertigt. „Er interessiert sich wirklich für niemanden. Auch für uns nicht. Er fährt weg, wir bleiben, das war’s.“
Serhij Zhadans Roman ist schwer zu ertragen und für mich, vielleicht gerade deshalb, der wichtigste Roman dieser Wochen. Die Fiktion ist Wirklichkeit geworden. Jeder Satz führt vor Augen, dass die Dystopie die Realität eingeholt hat. Das ist schmerzhaft und beängstigend. Zhadans Text erschüttert angesichts der Treffsicherheit seiner Prognose. Was kann Lesen nun noch ausrichten? Ich wünsche der ukrainischen Literatur viele Leser, weil die Aggression Putins ebenso auf die Kultur der Ukraine abzielt und weil jedes gekaufte und gelesene Buch dieses Landes ein Statement der Solidarität ist.
Serhij Zhadan: Internat
Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr
Suhrkamp Verlag 2019
ISBN 978-3-518-42805-4